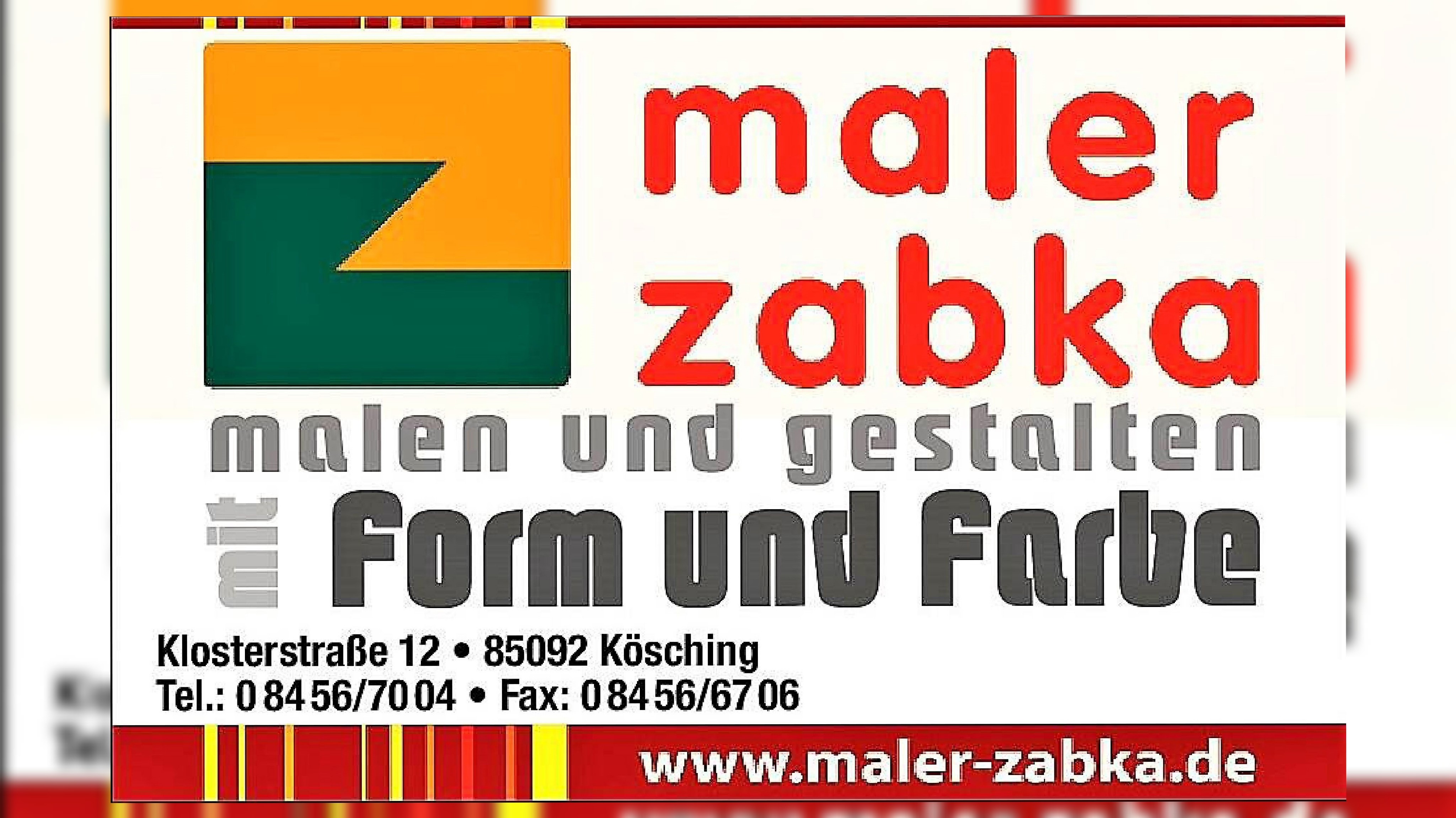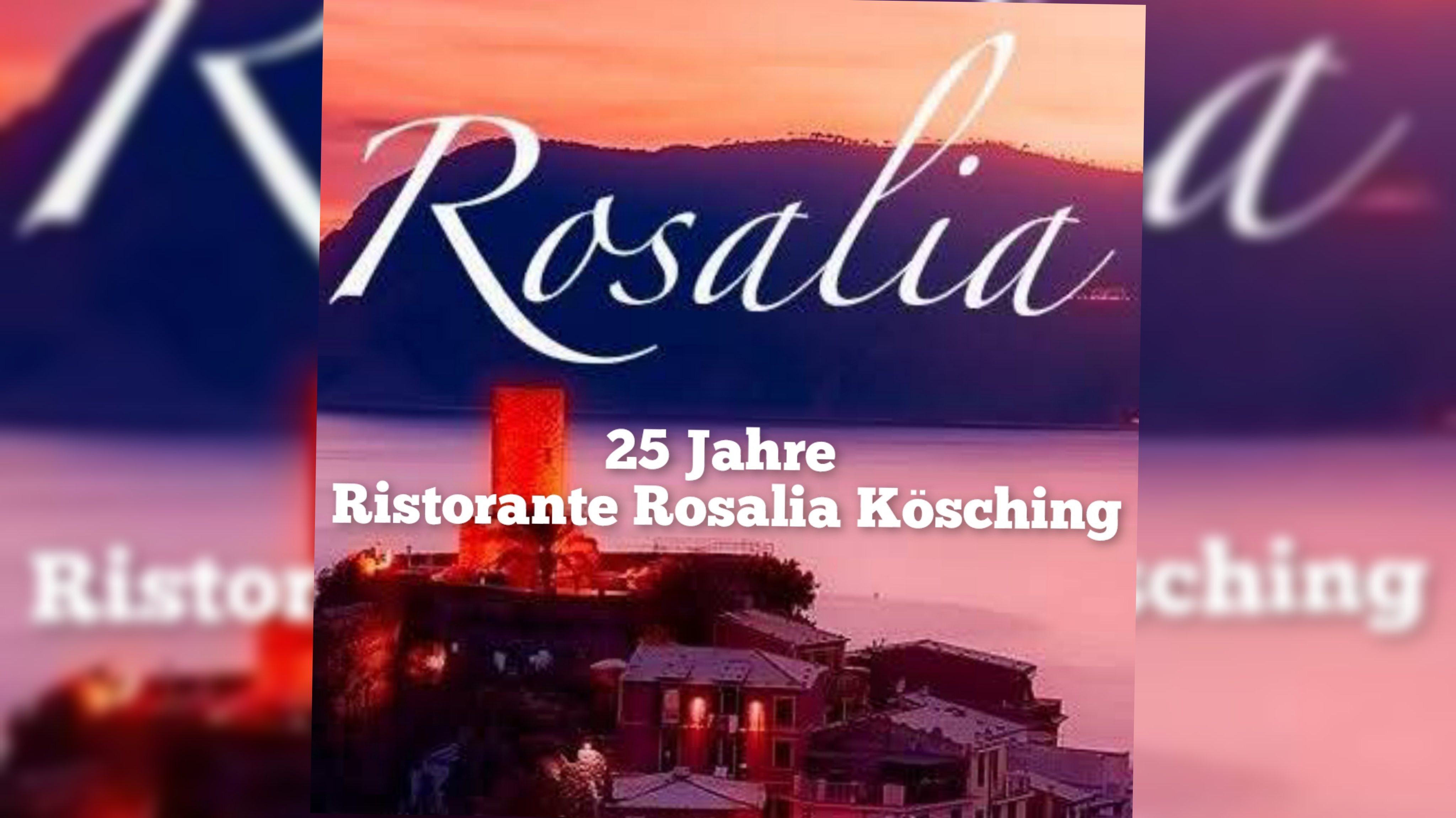(ka) Wer eine Photovoltaikanlage auf seinem Dach installiert hat, kann dank eines Batteriespeichers auch in der Nacht den selbst erzeugten Solarstrom nutzen. Dezentrale Stromspeicher gewinnen zunehmend an Bedeutung und spielen eine wesentliche Rolle in der Energiewende. Doch welche langfristigen Veränderungen bringt diese Innovation für unser Energiesystem mit sich, und wer ist für diesen Wandel verantwortlich? Diese Fragen wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts an der KU unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Martin Zademach, Professor für Wirtschaftsgeographie, untersucht.
Das von der DFG geförderte Projekt setzte sich mit dem rasanten Wachstum des Marktes für dezentrale Stromspeicher auseinander. Diese Systeme ermöglichen es, Solarstrom zwischenzuspeichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen. Dadurch kann der erzeugte Strom effizienter verwendet werden, und es muss weniger aus dem öffentlichen Stromnetz bezogen werden. Zudem entstehen zunehmend digitale Energiegemeinschaften, die über Plattformen vernetzt sind. Experten schätzen, dass private Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher bis zu 80 Prozent des privaten Strombedarfs decken könnten – ein wesentlicher Schritt in Richtung Energiewende.
„Technische Neuerungen allein genügen nicht, damit dieser Wandel gelingt“, betont Prof. Zademach. „Die entscheidende Frage ist, wie diese technischen Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft integriert werden können, um eine nachhaltige Transformation zu ermöglichen. Genau hier setzt unsere Forschung an.“ Ab 2020 untersuchte Zademach zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Andrea Käsbohrer „organisatorische und technologische Neuerungen im Markt für Stromspeicher“. Zunächst lag der Fokus auf der Innovationsentwicklung in diesem Bereich, doch die empirische Untersuchung zeigte, dass der regulatorische Rahmen das eigentliche Hindernis darstellt. Daher verschob sich das Team hin zu einer institutionellen Perspektive, um besser zu verstehen, wie Innovation in der Gesellschaft verankert wird.
Um Machtverhältnisse und Dynamiken zu analysieren, kam im Projekt ein Mixed-Methods-Ansatz zum Einsatz. Neben Experteninterviews aus Politik und Wirtschaft nutzte das Team auch ethnografische Methoden, wie die teilnehmende Beobachtung. Bei über 40 Sitzungen des zentralen Branchenverbands konnten die Forschenden Einblicke in tatsächliche Entscheidungsprozesse gewinnen. „Das war ein wesentlicher Vorteil, da wir durch Corona digital an vielen Treffen teilnehmen konnten“, berichtet Zademach. „So konnten wir institutionelles Handeln in Echtzeit beobachten.“
Die Studie verdeutlichte, dass große Unternehmen aus der Energie- und Automobilbranche zunehmend Marktanteile gewinnen, indem sie Stromspeicher gemeinsam mit E-Autos vertreiben. Kleinere, innovative Firmen bleiben oft auf der Strecke. „Manche dieser Unternehmen werden von etablierten Akteuren wie Mineralölkonzernen übernommen, die sich damit ein grünes Image zulegen wollen“, erklärt Zademach. Dies geschieht aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten, die einzelnen Akteure haben, um politische Entscheidungsträger auf deutscher und europäischer Ebene zu beeinflussen. „Wir konnten zeigen, wie stark Lobbystrukturen den Wandel prägen“, so Zademach.
In der aktuellen Ausgabe der international angesehenen Zeitschrift „Energy Policy" beleuchten Käsbohrer, Zademach und ihre Kollegin Karoline Rogge vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung die staatliche Regulierungsfähigkeit in der Energiewende, exemplifiziert am Beispiel der Verbreitung von Stromspeichern. Während sie unter Kanzlerin Angela Merkel eine kritische Zurückhaltung feststellen, beschreiben sie die Ampel-Koalition ab Ende 2021 als proaktiv und fördernd. „Der politische Wille in Teilen der Regierungskoalition führte zu mehr regulatorischem Wandel“, sagt Käsbohrer und verweist auf neue Stellen, Strukturen und Kooperationen, die die Eigenversorgung erleichtert, die EEG-Umlage abgeschafft und die Messanforderungen vereinfacht haben.
Diese „regulatorische Beschleunigung“ sei positiv zu bewerten, betont Zademach: „Alle sind sich einig, dass wir die Energiewende brauchen. Die zentrale Frage ist: Wie können wir sie schneller vorantreiben?“ Das DFG-Projekt zeigt auf, dass es in den Behörden ausreichende analytische Fähigkeiten und Ressourcen sowie vor allem politischen Willen für eine proaktive Rolle braucht. Andrea Käsbohrer, die seit April als Postdoc an der Universität Kopenhagen tätig ist, beschäftigt sich weiterhin mit der Frage, wie der strukturelle Wandel hin zur Nachhaltigkeit gesellschaftlich organisiert werden kann. Sie hebt hervor, dass bei der Regulierung auch breitere soziale Aspekte betrachtet werden müssen.
Quelle - KU Eichstätt - Ingolstadt / Pressemitteilung - Katja Ossiander / Bild von CreatingAsIGo auf Pixabay
WERBUNG